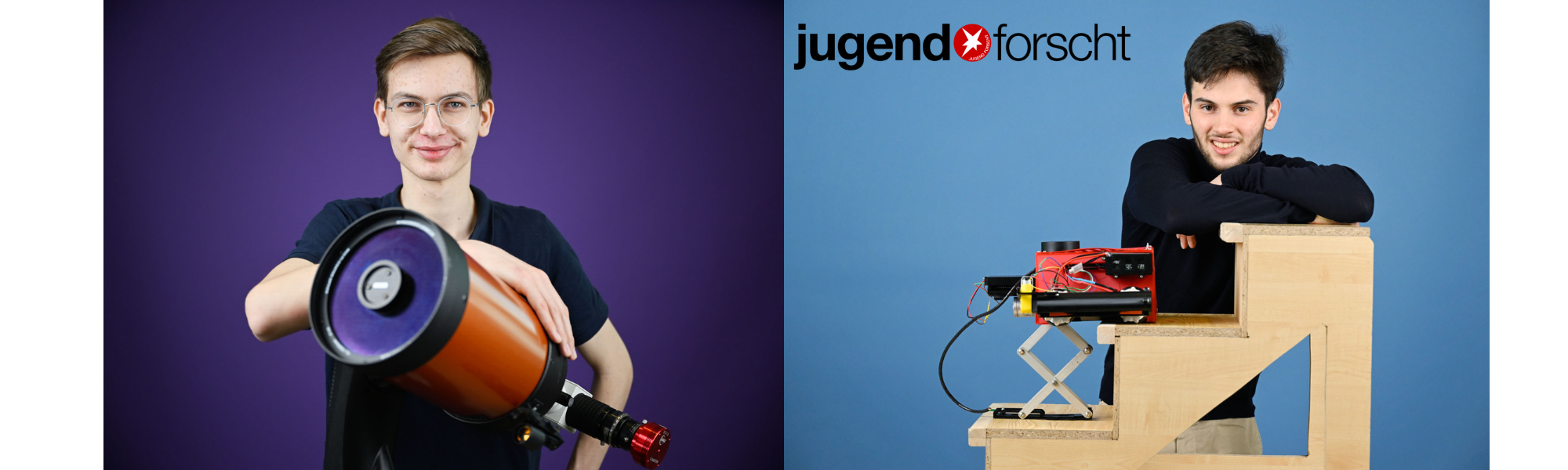Johnny - Leben und Lernen in Gemeinschaft
Als staatlich anerkannte, katholische Privatschule führen wir zu den gleichen Bildungsabschlüssen wie öffentliche Gymnasien. Wir stehen gleichwertig, aber nicht gleichartig neben den staatlichen Schulen. Wir sind eine christlich geprägte Schule, die allen Menschen guten Willens offen steht.
Wir verstehen unsere Schule als eine Erziehungsgemeinschaft von SchülerInnen, Lehrern und Eltern, die das Evangelium als Leitmotiv ihres Lebens annehmen. Unser Verständnis von Bildung und Erziehung steht auf der Grundlage des christlichen Menschen- und Weltbildes.